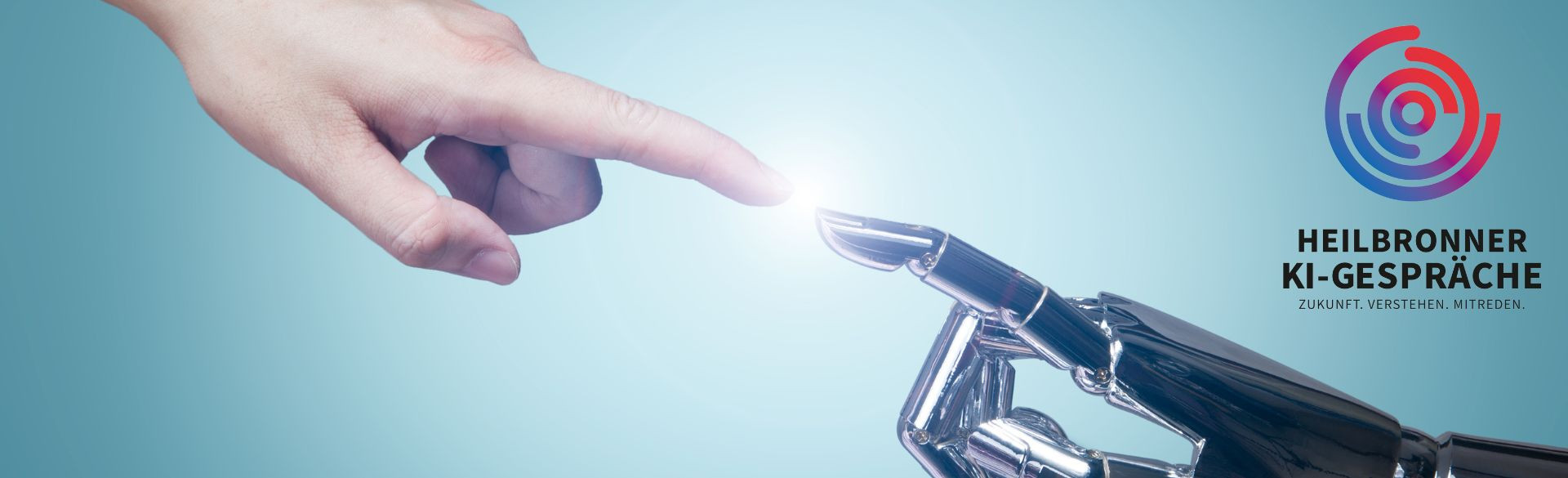Neues von den KI-Gesprächen
Wenn KI Sütterlin entziffert und Schweißpunkte prüft
Über 300 Interessierte bei KI-Gespräch mit Audi, Schunk und Bechtle
Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) zieht in Heilbronn: Rund 320 Besucher strömten zum Auftakt der zweiten Reihe der Heilbronner KI-Gespräche Anfang März 2024 ins Forum Bildungscampus und erlebten einen Abend mit spannenden Einblicken in KI-Anwendungen der regionalen Firmen Audi, Schunk und Bechtle.
Audi setzt die neue Technologie zum Beispiel bei der Kontrolle von Tausenden Schweißpunkten an neuen Autos ein. Mitarbeiter prüfen bei Unstimmigkeiten dann manuell nach. Bechtle setzt über die Tochterfirma Planet AI eine KI-Software ein, die handschriftliche Dokumente direkt in Computerschrift umwandelt. Sie schafft es auch, komplexe Sütterlin-Schrift zu übersetzen. Schunk wiederum nutzt KI für eine genaue Analyse von Vertriebsdaten, für den flexiblen Einsatz von Robotern und hat auch ein eigenes GPT-Sprachmodell für Mitarbeiter erstellt. In der von Carsten Friese (Kommunikation Stadt Heilbronn) moderierten Gesprächsrunde betonten alle drei Referenten, dass Künstliche Intelligenz ein wichtiger Faktor sei, um Prozesse zu beschleunigen und eine große Chance zur Linderung des Fachkräftemangels. KI solle Prozesse verbessern, einfache, sich wiederholende Arbeiten übernehmen, so dass sich Mitarbeiter auf anspruchsvolle Aufgaben konzentrieren könnten. Die Referenten Andreas Kühne (Audi), Martin May (Schunk) und Jesper Kleinjohann (Bechtle) betonten, dass mit dem Einsatz von KI in ihren Bereichen keine Beschäftigten entlassen worden seien.
Mitschnitt der Veranstaltung
Rückblick
Wie ein Computer intelligent wird
Ausgebuchter Auftakt der Heilbronner KI-Gespräche: Prof. Stache (Hochschule Heilbronn) führt anschaulich ins Thema ein.
Ist Künstliche Intelligenz (KI) nur etwas für Experten? Von wegen. Rund 200 Gäste füllen zum Auftakt der neuen Reihe „Heilbronner KI-Gespräche“ im Oktober 2023 den Abraham-Gumbel-Saal der VR-Bank Heilbronn und sind gespannt auf Antworten auf die Frage „Was genau ist KI?“. Der Saal ist ausgebucht, die gemeinsame Veranstaltung von Volkshochschule und Stadt Heilbronn kommt an.
Auch Oberbürgermeister Harry Mergel ist angetan von dem guten Zuspruch – und erklärt, dass man die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen möchte, wenn Heilbronn mit den Hochschulen, Forschungsinstituten und besonders durch den Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) zur KI-Stadt werde. „KI gilt als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Und wir möchten Ihnen Orientierung geben auf dem komplexen Feld“, sagt Mergel. Zumal der Aufbau des Ipai – ein KI-Zentrum von internationalem Format im Areal Steinäcker nahe den Böllinger Höfen – auch die Stadtentwicklung und Wirtschaftskraft von Heilbronn nachhaltig stärken werde.
Professor Nicolaj Stache, Direktor des Zentrums für Maschinelles Lernen an der Hochschule Heilbronn, verdeutlicht in seinem anschaulichen Vortrag, dass Künstliche Intelligenz die Fähigkeit von Computern bedeutet, intelligentes menschliches Verhalten nachzuahmen. Er sieht die aktuelle KI als Helfer für den Alltag, eine bestimmte Aufgabe lösen.
Ohne intensives Training mit Daten geht es bei KI nicht
Nur: Wie macht ein Computer das - wie wird er „intelligent“? Eifriges Training mit Daten ist die entscheidende Basis. Stache macht Beispiele: Indem man dem Computer beim Projekt autonomes Fahren immer wieder Bilder von Ampeln vorlege, lerne er zu erkennen, was eine Ampel ist. In der Medizin sei dies mit Bildern von Tumorzellen ähnlich. Durch neue Schritte und Anpassungen lerne der Computer, immer bessere Vorhersagen zu machen. Aber: Es seien viele Schritte und viele Daten nötig, was hohe Kosten bedeute. Das neueste GPT-Sprachmodell basiere auf rund 1,5 Billionen Parametern. „Eine umwerfend hohe Zahl.“
Daten, Training, hohe Rechenleistung und menschliche Expertise beim Auswählen der richtigen Vorgaben seien wichtige Elemente für KI-Prozesse. Unseren Alltag, so Stache, habe KI längst durchdrungen, beim Autofahren, bei der Handynutzung, dem Einsatz von Sprachassistenten wie Alexa und Siri oder eines Saugroboters.
Chancen und Risiken im Fokus
KI schafft große Chancen, birgt aber auch Risiken. Stache listet auf: KI hilft, Prozesse zu vereinfachen, kann Sprachbarrieren abbauen, Ressourcen besser einsetzen, sie hilft, den stetig steigenden Wissensschatz zu erschließen. Aber: Sie kann durch Fake-Bilder auch täuschen, Menschen manipulieren, kann militärisch wie in Drohnen eingesetzt werden oder lebensentscheidende Prozesse wie z.B. eine Vergabe eines Kredites beeinflussen. Wichtig sei, dass wir genau prüfen, welche Informationen wir von wem erhalten – und wie seriös sie einzuschätzen sind.
In virtuellem KI-Labor viele Informationen gebündelt
Das virtuelle KI-Labor auf der Internetseite der Hochschule bietet verschiedene Inhalte. Auf einem animierten Rundgang durch verschiedene Gebäude können Interessierte sich zu Themen wie KI und Bildung, KI und Nachhaltigkeit, KI und Produktion, Gesellschaft oder Mobilität informieren. Die Hochschule zeigt auch, woran sie mit KI gerade forscht. Eine KI-Sprechstunde und Hilfestellung bei Fragen zu KI und Recht vor allem für Unternehmen sind mit im Angebot.
Lust auf noch mehr KI?
Die KI-Gespräche sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von Stadt Heilbronn und Volkshochschule Heilbronn. Ziel der KI-Gespräche ist, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen auf dem Weg von Heilbronn zur KI-Stadt mit dem entstehenden KI-Innovationspark IPAI, den KI-Forschungen und –anwendungen an den Heilbronner Hochschulen und Instituten. Es soll ein Grundwissen aufgebaut und Orientierung gegeben werden in einem Feld, das als Schlüsseltechnologie der heutigen Zeit gilt.